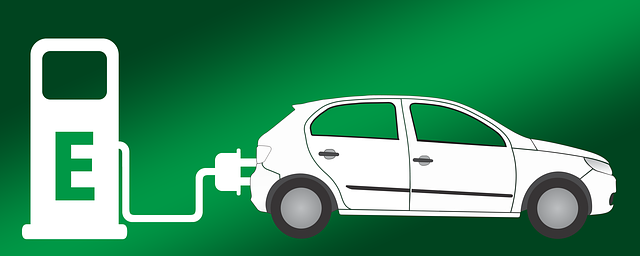Insgesamt scheinen die Hersteller die Dringlichkeit des Umbaus erkannt zu haben, wollen sie nicht als "Auto-Dinos" für die Folgen des Klimawandels mitverantwortlich gemacht werden. Bei VW fließen bis 2024 rund 33 Milliarden Euro in die E-Mobilität. Ein eigenes Batteriezellwerk ist in Planung, die Konkurrenz kauft zunächst weiter zu – BMW etwa vom chinesischen CATL-Konzern.
Die Bayern – mit dem i3 einst Pionier bei Elektrokleinwagen – halten sich die Entscheidung für eine dominante Antriebsform noch offen. Bis 2023 will BMW 25 E-Modelle im Programm haben, mehr als die Hälfte davon vollelektrisch. Daimler setzt auf die Elektro-Reihe EQ, vor allem mit dem SUV EQC und dem Minibus EQV.
Derweil macht sich Erzrivale Tesla ausgerechnet am Berliner Stadtrand breit: Im brandenburgischen Grünheide will Gründer Elon Musk eine "Gigafactory" mit bis zu 7000 Jobs bauen. Voraussichtlich von Ende 2021 an sollen der Kompakt-SUV Model Y, Batterien und Antriebe gefertigt werden. In Berlin selbst entsteht ein Ingenieur- und Designzentrum. Bedroht dies Arbeitsplätze bei den deutschen Platzhirschen? Die Chefs bemühen sich, die Kampfansage aus den USA als Ausdruck sportlichen Ehrgeizes zu interpretieren: Der Innovationsschub nutze allen. Bisher tat sich Tesla schwer, E-Autos in großen Stückzahlen zu produzieren.
Vernetzung – "Made in Germany" gegen US-Tech-Giganten
Auch bei diesem Megatrend sind die Amerikaner den Deutschen in mancherlei Hinsicht voraus. Digitalisierung heißt weitere Automatisierung der Fertigung in den Fabriken – besonders aber steigende Vernetzung von Funktionen im Auto selbst. Dieses wird zum rollenden Smartphone. Der neue VW Golf etwa ist ständig online, alle Instrumente sind digital, es gibt ein Infotainmentdisplay und Projektionen im Fahrer-Sichtfeld.
Aus eigener Kraft können die Hersteller all dies kaum stemmen. VW setzt auf Cloud-Dienste und schloss eine Partnerschaft mit Microsoft. Die Idee ist, künftig ganze Flotten zu steuern – samt Kundendienst, Inspektionen und Schnittstellen zu Services wie Lade- und Abrechnungs-Software für Elektroautos. Es geht um ein umfassendes Online-"Ökosystem". Auch andere Anbieter investieren hier viel.
Die Autos der Zukunft kommunizieren zudem untereinander ("car-to-car") sowie mit der Infrastruktur ("car-to-x") – das soll den Verkehrsfluss optimieren. Zulieferer wie Continental sind hier gut im Geschäft, doch die Konkurrenz aus den USA und China schläft nicht. Weitgehend offen ist noch, welche Datenschutz-Standards für die erwarteten riesigen Informationsmengen gelten sollen.