Haben die Kleingartenvereine und deren Mitglieder in den neuen Bundesländern überhaupt gültige Pachtverträge, die auf der Grundlage des Bundeskleingartengesetzes abgeschlossen wurden?
Die ehemaligen DDR-Kleingartensparten und deren Mitglieder hatten zu DDR-Zeiten Pachtverträge mit dem DDR - „Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter“ (VKSK) abgeschlossen bzw. die Vorstände der Kleingartensparten durften in Vollmacht des VKSK Pachtverträge abschließen.
Beweis: Kopie eines Pachtvertrages vom 17.06.1974, als Beispiel zur Kenntnisnahme, Anlage 1
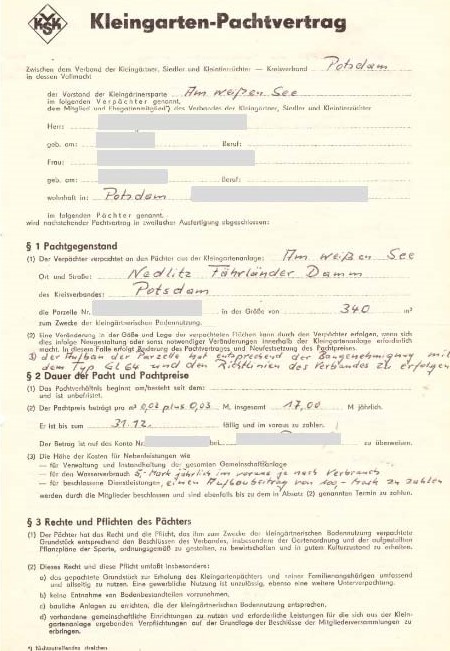

Nach der Wende lösten sich die Mitglieder des Kleintierzüchterverbandes aus dem VKSK heraus und gründeten nach BRD-Recht ihren eigenen Verein. Der Rest des VKSK gründete dann auf der Grundlage des Bundeskleingartengesetzes (BKleingG) den „Kreisverband der Garten und Siedlerfreunde e.V.“(VGS). In der Folge gründeten dann auch die Mitglieder der DDR-Kleingartensparten BRD-Vereine auf der Grundlage des BKleingG, da man ihnen suggerierte, daß dann ihre Kleingärten für die Zukunft sicher wären. Im Anschluß wurden dann neue Pachtverträge zwischen den Mitgliedern der neuen Kleingartenvereine und dem VGS auf der Grundlage des BKleingG abgeschlossen.
Beweis: Kopie Pachtvertrag vom 29.11.1994, als Beispiel zur Kenntnisnahme, Anlage 2
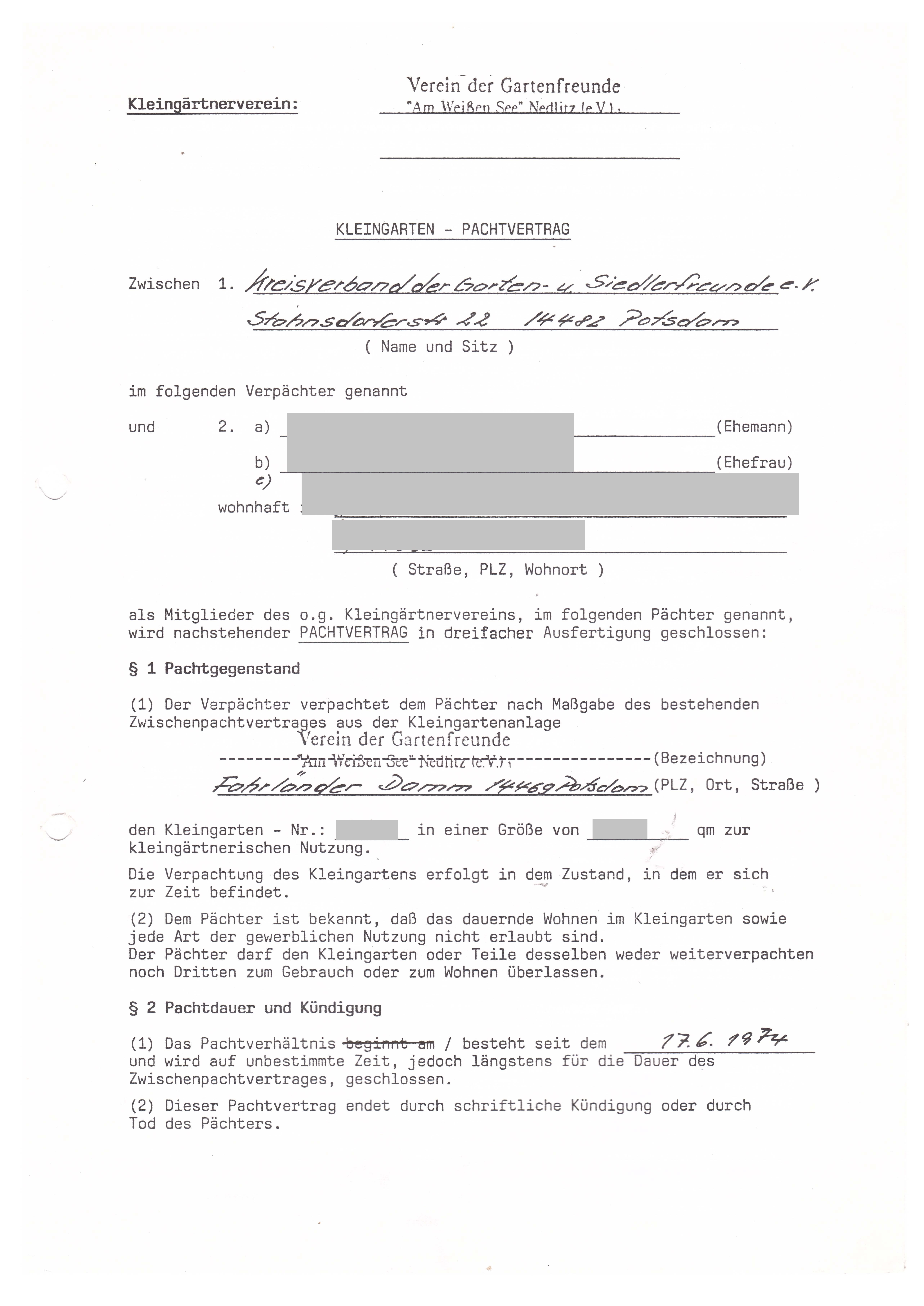
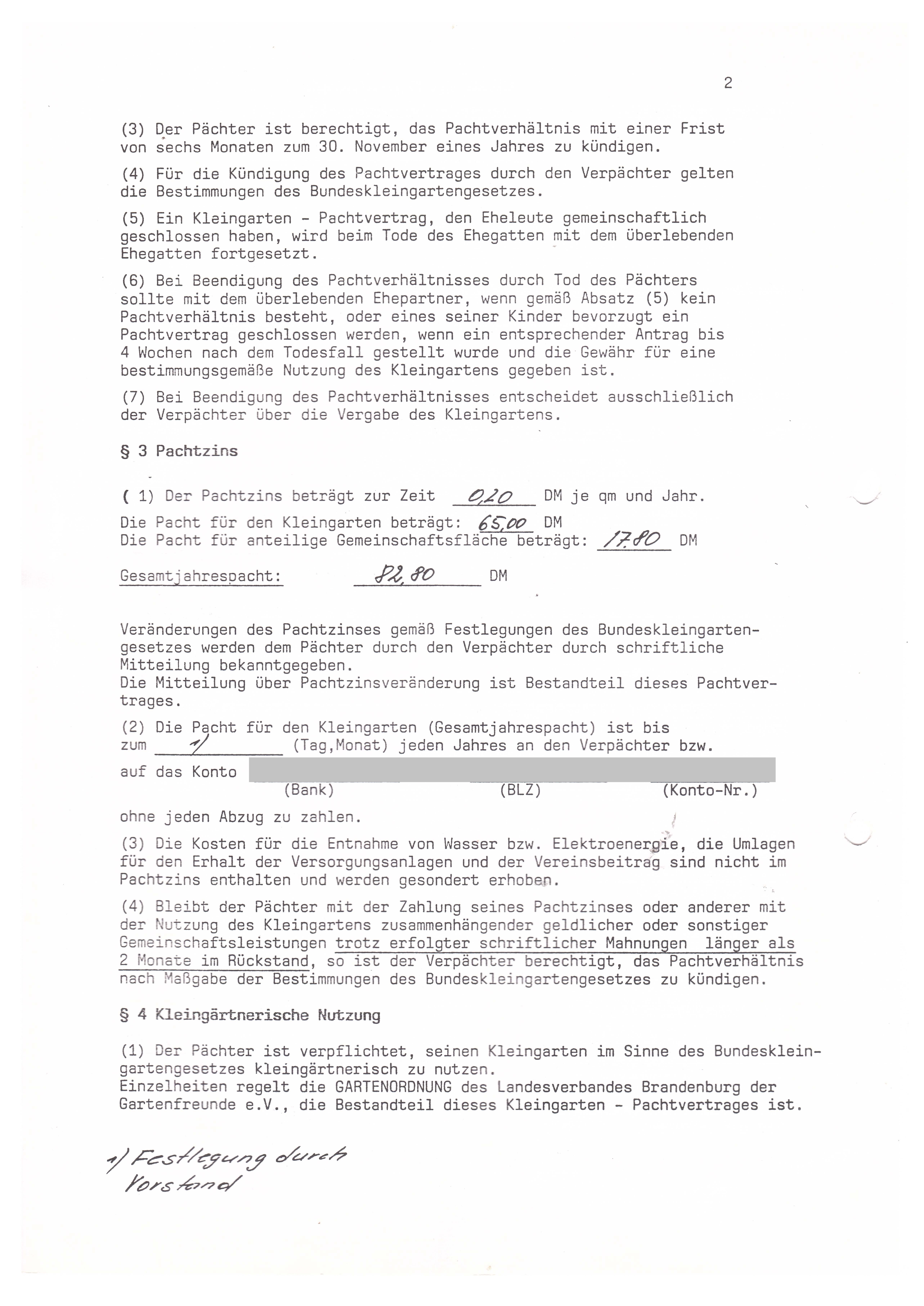
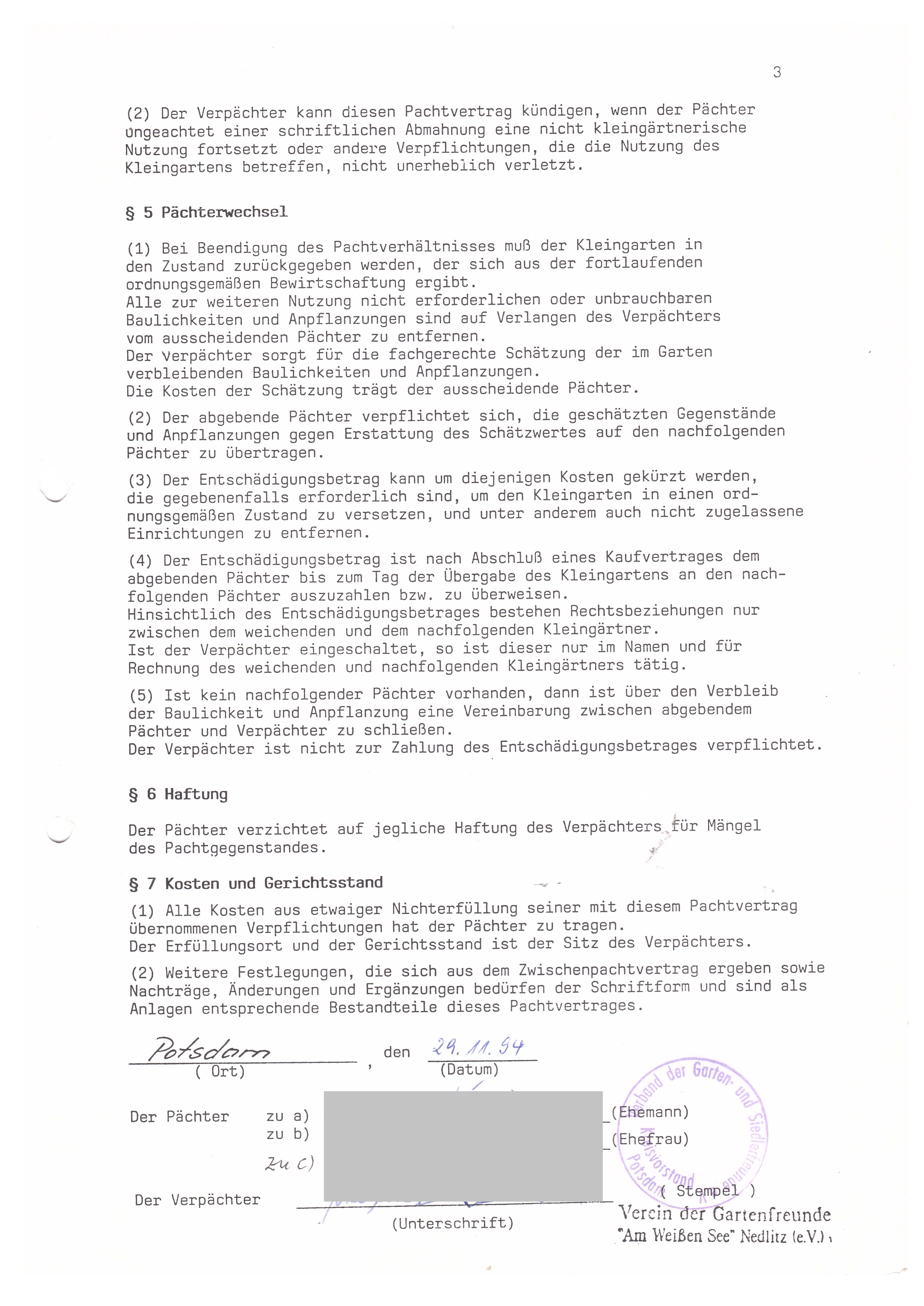
Bei der Gründung der Kleingartenvereine haben die Mitglieder sicherlich nicht gewußt, daß das BKleingG auf dem Territorium der DDR bzw. in den neuen Ländern der DDR nicht rechtswirksam in Kraft getreten ist und es auch nicht konnte. In dem BKleingG findet man unter § 20a Überleitungsregelungen aus Anlaß der Herstellung der Einheit Deutschlands nachfolgend:
„In dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet ist dieses Gesetz mit folgenden Maßgaben anzuwenden:……..“
Dieser § 20a des BKleingG setzt nämlich voraus, daß ein wirksamer Beitritt der neuen Länder der DDR, welche auf der Grundlage des DDR-Ländereinführungsgesetzes gebildet wurden, auf der Grundlage des Artikel 23, Absatz 2 des Grundgesetzes zur BRD erfolgt ist. Um das zu verstehen, ist es zunächst notwendig, Kapitel 1 Wirkung des Beitritts den Artikel 1. Länder des Einigungsvertrages vom 23. September 1990 sich genauer anzuschauen, denn da steht:
„Mit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes am 3. Oktober 1990 werden die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Länder der Bundesrepublik Deutschland. Für die Bildung und die Grenzen dieser Länder untereinander sind die Bestimmungen des Verfassungsgesetzes zur Bildung von Ländern in der Deutschen Demokratischen Republik vom 22. Juli 1990 - Ländereinführungsgesetz - (GBl. I Nr. 51 S. 955) gemäß Anlage II maßgebend.“
Nach dem Ländereinführungsgesetz der DDR vom 22. Juli 1990 – veröffentlicht im Gesetzblatt der DDR Teil I Nr. 51, S. 955 vom 14. August 1990 wurde im § 1 Absatz 1 festgelegt, daß mit Wirkung vom 14. Oktober 1990 in der DDR die DDR-Länder gebildet werden. Unter § 25 war das Inkrafttreten des Gesetzes mit 14. Oktober 1990 ebenfalls festgelegt.
Beweis: Kopie Ländereinführungsgesetz der DDR vom 22. Juli 1990, Anlage 3
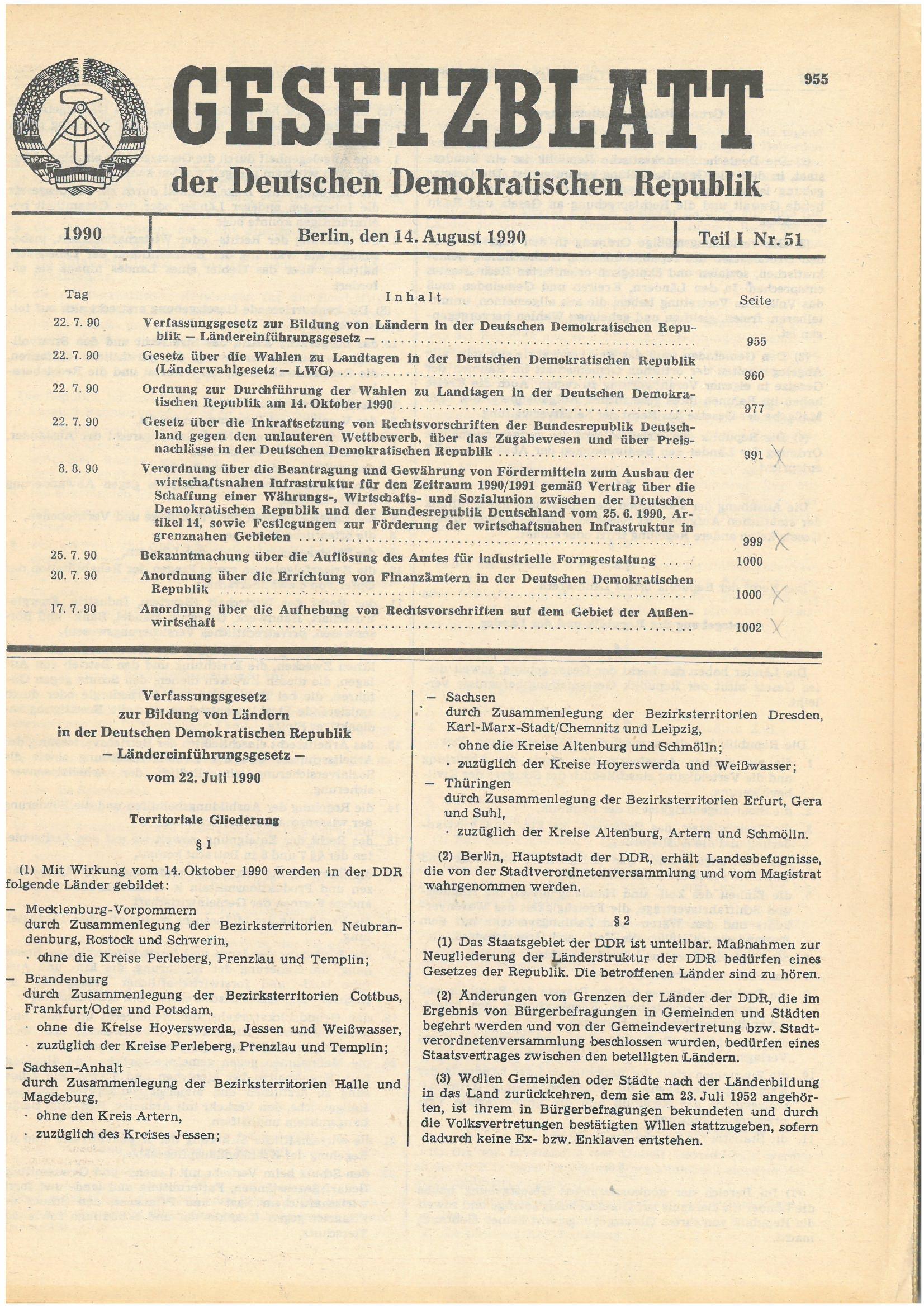
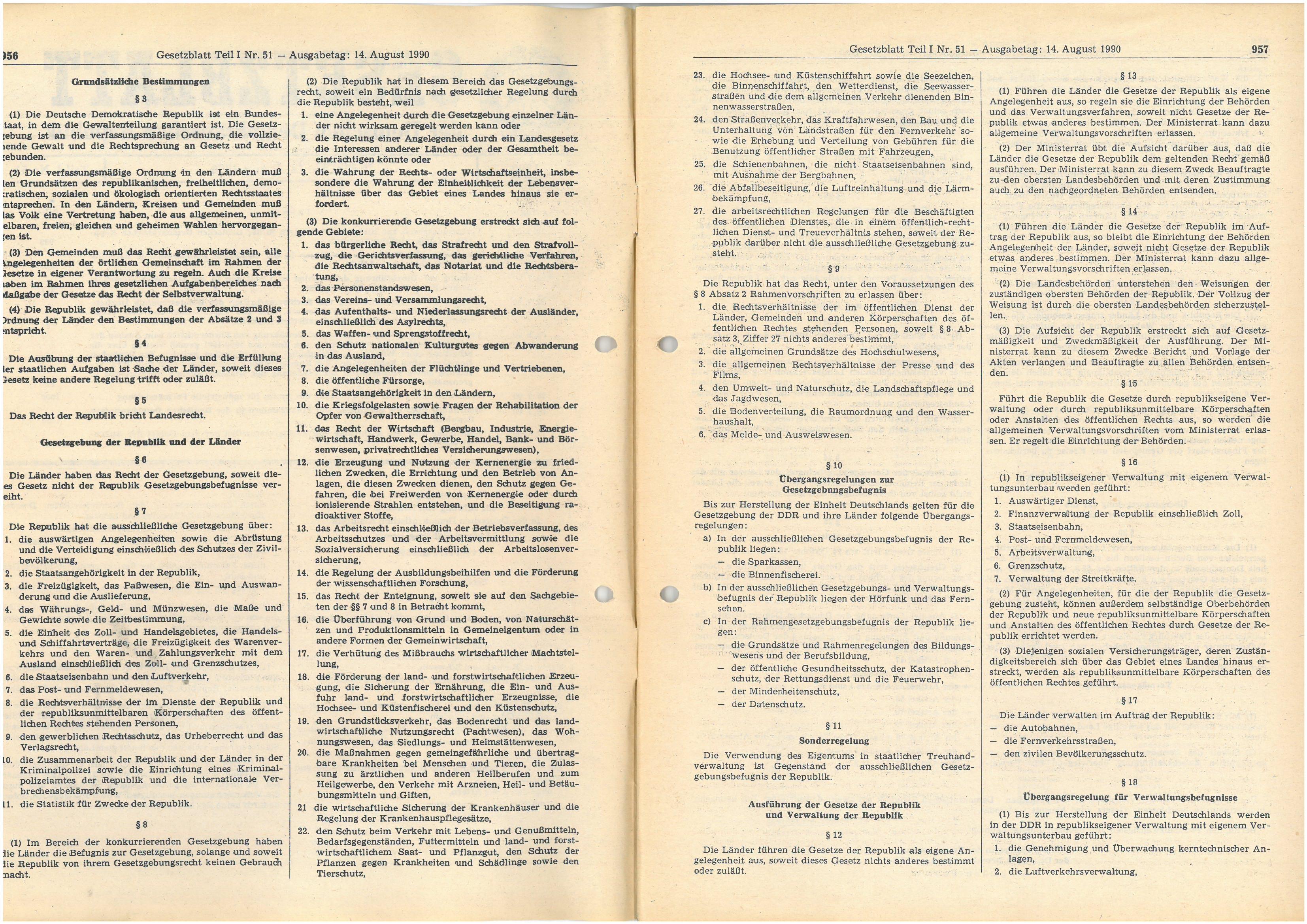

Es ist unvorstellbar, daß dieses Ländereinführungsgesetz der DDR vom 22. Juli 1990 durch das Verfassungsgesetz vom 13. September 1990 (GBl. I S. 1567) und dem Einigungsvertrag vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 889), Anl. II, Kap. II. Sachgeb. A, Abschn. II. derart vergewaltigt wurde, daß von 25 Paragraphen 21 davon gelöscht und die restlichen 4 Paragraphen ebenfalls teilweise gelöscht bzw. geändert wurden. In Anbetracht dieser massiven Änderungen eines damals erst kürzlich erlassenen Gesetzes kann man konkludent zu dem Ergebnis kommen, daß bei diesem Rudiment eines Gesetzes wohl kaum noch von einem Verfassungsgesetz gesprochen werden kann.
Beweis: Kopie Ländereinführungsgesetz, geändert durch Verfassungsgesetz vom 13. September 1990 (GBl. I S. 1567) und Einigungsvertrag vom 23. September 1990, Anlage 4 und Anlage 5
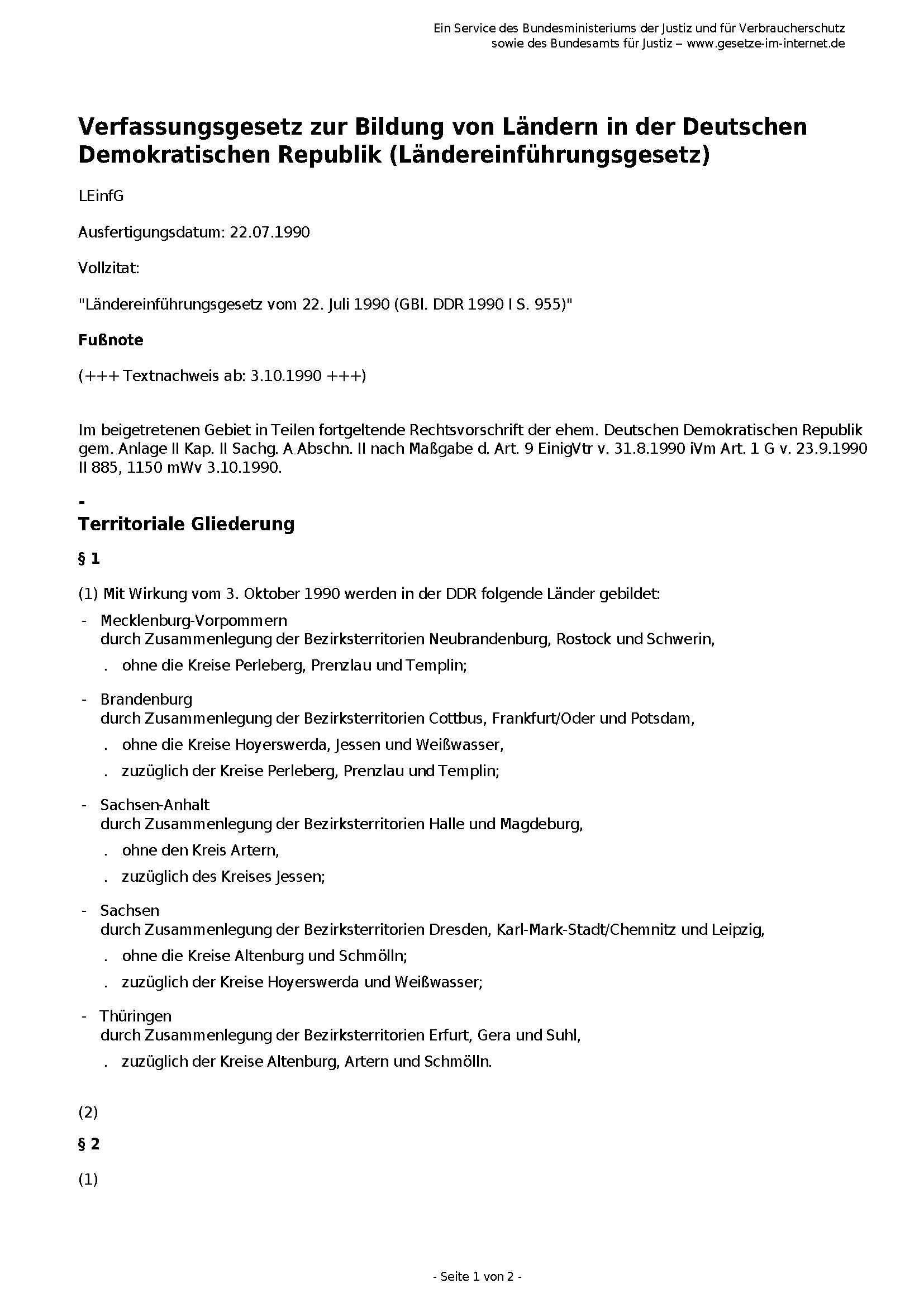

Anlage 5 als PDF-Download
Verfassungsgesetz zur Bildung von Ländern in der Deutschen Demokratischen Republik - Ländereinführungsgesetz -vom 22. Juli 1990, geändert durch Verfassungsgesetz vom 13. September 1990 (GBl. I S. 1567), Einigungsvertrag vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 889), Anl. II, Kap. II. Sachgeb. A, Abschn. II.,gilt nach dem 3. Oktober 1990 teilweise als einfaches Bundesrecht fort
Und was steht unter Artikel 3. Inkrafttreten des Grundgesetzes beim Einigungsvertrag vom 23. September 1990?
„Mit dem Wirksamwerden des Beitritts tritt das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 1983 (BGBl. I S. 1481), in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in dem Teil des Landes Berlin, in dem es bisher nicht galt, mit den sich aus Artikel 4 ergebenden Änderungen in Kraft, soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist.
Und was ist in Artikel 4. Beitrittsbedingte Änderungen des Grundgesetzes festgelegt?
Punkt 2.: Artikel 23 des Grundgesetzes wird aufgehoben!
Dieser Einigungsvertrag vom 23. September 1990 zwischen der DDR und der BRD wurde im BGBl. II 885 am 29.09.1990 veröffentlicht. Somit gilt die Löschung des Artikels 23 des Grundgesetzes seitdem 23. September 1990 (Einigungsvertrag) und spätestens zum 29.09.1990 dem Tag der Veröffentlichung des Einigungsvertrages im BGBl. als rechtlich verbindlich.
Für den normaldenkenden Menschen stellt sich die Frage, wie konnte die DDR wirksam der BRD gemäß Artikel 23 beitreten, wenn im gleichen Vertrag dieser Artikel 23 des Grundgesetzes gelöscht wurde? Wie sollten die Länder der DDR am 3. Oktober 1990 Länder der BRD werden, wenn sie erst am 14. Oktober 1990 geschaffen wurden und zu diesem Zeitpunkt das Grundgesetz über keinen Geltungsbereich mehr verfügte und somit der BRD deren Rechtsgrundlage für einen Beitritt fehlte?
Somit dürfte zweifelsfrei geklärt sein, dass u.a. auch das BKleingG auf dem Territorium der DDR bzw. den neuen DDR-Ländern nicht rechtswirksam in Kraft getreten ist.
Nun hat der BGH in seinem Urteil Az. III ZR 179/04_BGH 16. Dezember 2004 feststellt, dass die "Neugründungen" der Vereine und Verbände auf der Grundlage des BKleingG nicht den Rechtsnachfolger des DDR - „Verbands der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter“ (VKSK) darstellen, da diese Vereine und Verbände parallel zum VKSK gegründet, keine Verschmelzung mit dem VKSK stattgefunden und auch die Übernahme der Rechte und Pflichten des VKSK nicht vorgenommen wurden.
Der BGH geht in seinem Urteil weiter davon aus, daß der „Kreisverband der Garten und Siedlerfreunde e.V.“(VGS) sich nicht in der erforderlichen Zwischenpächterposition befand und befindet, um rechtswirksame Pachtverträge abschließen zu können. Dem „Kreisverband der Garten und Siedlerfreunde e.V.“(VGS), z.B. in der Paul-Neumann-Str. 33A, 14482 Potsdam, Steuernummer: 046/142/01865K02 sollte dieses Urteil des BGH vom 16. Dezember 2004 bekannt sein.
Da das BKleingG gemäß des § 20a dieses Gesetzes unter Bezugnahme auf Artikel 3 des Einigungsvertrages auf dem Territorium der DDR, den neuen DDR-Ländern, nicht rechtswirksam in Kraft treten konnte, dürfte diesen neugeründeten Vereinen und Verbänden offenkundig die Rechtsgrundlage ihres Handelns fehlen. Die Kleingartenvereine haben mit ihrer Gründung auf der Grundlage des BKleingG nicht die Rechte und Pflichten aus der DDR-Zeit und vom VKSK übernommen.
Wie sind unter diesen Gegebenheiten die Pachtverträge des VGS mit den Mitgliedern seiner 144 Vereine in Potsdam Stadt und Landkreis Potsdam-Mittelmark zu bewerten, wenn der VGS sich nicht in der zwingend erforderlichen Zwischenpächterposition befindet, wie der BGH in seinem Urteil festgestellt hat, um rechtswirksame Pachtverträge abschließen zu können?
Es scheint offenkundig zu sein, daß der VGS wider besseren Wissens Pachtverträge mit den Mitgliedern seiner Vereine abschließt bzw. abgeschlossen hat, ohne dazu berechtigt bzw. berechtigt gewesen zu sein.
Im Schuldrechtsanpassungsgesetzes (SchuldRAnpG), Anlage 7, Ausfertigungsdatum: 21.09.1994 ist im § 1 Absatz 2 geregelt, daß dieses Gesetz nur dann Anwendung findet, wenn das Grundstück einem anderen als dem unmittelbaren Nutzungsberechtigten (Zwischenpächter) zum Zwecke der vertraglichen Überlassung an Dritte übergeben wurde. Diese Rechtsposition hat offensichtlich der VGS nie eingenommen bzw. konnte der VGS diese Position nicht einnehmen.
Inwieweit dieses SchuldRAnpG überhaupt Anwendung finden kann, ist zweifelhaft, denn im Kapitel 1, Abschnitt 1, § 1 ist festgeschrieben, daß dieses Gesetz nur Rechtsverhältnisse an Grundstücken in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet (Beitrittsgebiet) regelt. Da weder die DDR noch ihre Länder gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes der BRD beigetreten sind bzw. gar nicht beitreten konnten, sollten die Regelungen und Festlegungen dieses SchuldRAnpG irrelevant sein.
Wenn es dem VGS durch fehlende Übernahme der Rechte und Pflichten des VKSK unmöglich ist, die zwingend erforderlichen Zwischenpächterposition einzunehmen, also in die Verträge mit den Grundstückseigentümer einzutreten, dann kann der Nutzer (Mitglied des Kleingartenvereins, als Pächter) unbeschadet des gesetzlichen
Vertragseintritts Schadensersatz von dem anderen Vertragschließenden, hier dem VGS, verlangen.
Da der BGH in seinem Urteil Az. III ZR 179/04_BGH 16. Dezember 2004 festgestellt hat, daß der VGS seit seiner Gründung zu keinem Zeitpunkt sich in der erforderlichen und notwendigen Zwischenpächterposition befand und somit befindet, ist die Rechtmäßigkeit der abgeschlossenen Pachtverträge fraglich.
- Wie ist auch das Agieren des VGS zu bewerten, wenn der VGS gerichtlich gegen Mitglieder von Kleingartenvereine vorgeht ohne hierfür die Aktivlegitimation nachweisen zu können?
- Was ist mit der Pacht, die die Mitglieder der Kleingartenvereine an den VGS zahlen bzw. gezahlt haben?
- Was passiert mit den Kleingartenvereinen, die Pachtverträge mit dem VGS auf der Grundlage des BKleingG abgeschlossen haben und die offenkundig rechtsunwirksam bzw. nichtig sind?
Bei gegebener Sach- und Rechtslage im Zusammenhang des Agierens des VGS liegt die Vermutung nahe, daß hier mehrere Straftatbestände wie Betrug, Täuschung im Rechtsverkehr und ein besonders schwerer Fall des Bankrotts nach § 283a Punkt 2 StGB vorliegen könnten.
Bild: Pixabay



